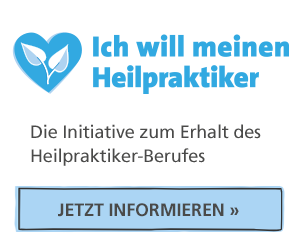Was tun, wenn kein Therapieplatz in Sicht ist?

Die Suche nach einer psychotherapeutischen Behandlung kann sich in Deutschland als langwieriger und belastender Weg entpuppen. Viele Betroffene geraten in eine Abwärtsspirale. Nicht, weil sie keine Hilfe suchen, sondern weil es schlicht keinen Platz gibt. Wartezeiten, bürokratische Hürden und regionale Engpässe machen die Situation für viele Menschen unerträglich. Doch es gibt Wege, wie Du aktiv bleiben und den Überblick behalten kannst. Dieser Beitrag zeigt Dir Schritt für Schritt, wie Du besser durch die Psychotherapie-Unterversorgung kommst.
Zahlreiche Betroffene, zu wenige Plätze
- Hohe Nachfrage: Jeder dritte Deutsche entwickelt im Leben eine psychische Erkrankung, doch nur ein Teil davon nimmt auch Hilfe in Anspruch.
- Zahl der Therapeuten ist begrenzt: 2021 waren bundesweit etwa 48.000 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in der ambulanten Versorgung aktiv, verteilt auf alle Versorgungsformen.
- Versorgungswüste auf dem Land: In ländlichen Regionen sind oft deutlich weniger Sitzungen pro 100.000 Einwohner möglich, in Großstädten hingegen um ein Vielfaches.
Das Problem liegt systemisch: die Bedarfsplanung limitiert die Anzahl neuer Kassensitze, historisch gesetzlich festgelegt seit 1999. Viele Krankenkassen wie die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER übernehmen die Kosten für eine Psychotherapie (unter der Voraussetzung, dass die Behandlung vor dem Start beantragt wird und Patienten einen zugelassenen Therapeuten aufsuchen). An einen der begehrten Plätze zu kommen, gestaltet sich jedoch als eine langwierige Angelegenheit.
142 Tage musst Du im Schnitt laut Bundes Psychotherapeuten Kammer auf einen Therapieplatz warten, also circa 20 Wochen vom Erstgespräch bis zum Therapiebeginn. Dabei gibt es große regionale Unterschiede: In Städten nur rund zwei Monate, in ländlichen Regionen bis zu sechs Monaten. Auch nach einer Strukturreform im Jahr 2017 gab es keine deutliche Besserung. Eine Studie zeigte, dass die Dauer zwischen Erstkontakt und Erstgespräch bei drei Wochen blieb, die Therapie verzögerte sich weiter von 18 auf 20 Wochen.
Ursachen für das Ungleichgewicht
- Begrenzte Zulassung: Neue Kassensitze entstehen nur in Ausnahmefällen – etwa Kinder- und Jugendtherapie – und bleiben meist fix vergeben.
- Stark gestiegener Therapiebedarf:
- Erwachsene: + 40 Prozent
- Kinder/Jugendliche: + 60 Prozent seit Corona
- Prognose: + 23 Prozent bis 2030
- Stadt‑Land-Gefälle: führt zur Belastung ambulanter wie auch stationärer Strukturen.
Die Folge: Psychiatrien arbeiten bis zu 116 Prozent ihrer Kapazität und erste Betroffene wandern ins System Krankenhaus. Denn der Kampf gegen die Bürokratie und die Wartezeiten, zum Teil bei mehrfacher Praxissuche und erneuten Vorgesprächen, verstärken die psychische Belastung. Die eigentliche Therapie beginnt häufig erst ein halbes Jahr nach dem ersten Schritt.
Warum viele Menschen das System frustriert aufgeben
Viele geben nach dem fünften oder sechsten vergeblichen Anruf bei einer Praxis auf. Laut einer Umfrage der Bundespsychotherapeutenkammer hat fast jede bzw. jeder zweite Betroffene Schwierigkeiten, überhaupt Kontakt zu einem Therapeuten zu bekommen. Noch frustrierender ist, dass es selbst nach einem Erstgespräch sein kann, dass keine freien Plätze verfügbar sind und Du wieder von vorn beginnen musst:
- Symptome verschlimmern sich
- Arbeitsunfähigkeit oder Isolation nehmen zu
- Menschen ziehen sich zurück oder fühlen sich mit ihren Problemen alleingelassen
Gerade in dieser Phase ist es entscheidend, nicht in Passivität zu verfallen. Je aktiver Du in der Suche bleibst, desto höher ist die Chance, zeitnah einen Platz zu finden – auch wenn es schwerfällt.
Was Du tun kannst, wenn Du akut Hilfe brauchst
Wenn Du Dich gerade in einer akuten Krise befindest, solltest Du nicht auf einen Therapieplatz warten, sondern sofort handeln. Dafür gibt es folgende Anlaufstellen:
- Telefonseelsorge: kostenfrei & anonym unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
- Sozialpsychiatrische Dienste: in jeder größeren Stadt, oft erreichbar über das Gesundheitsamt
- Krisenpraxen & Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung: Tel. 116 117
- Psychiatrische Kliniken mit Notaufnahme: 24/7 geöffnet, auch ohne Einweisung
Diese Stellen bieten keine dauerhafte Therapie, aber sie können im Notfall stabilisieren und Zeit überbrücken.
Welche Therapieform ist für Dich passend?
Nicht jeder sucht nach der gleichen Form von Unterstützung. Je nach Symptomatik, Persönlichkeitsstruktur und Lebenssituation bieten sich unterschiedliche Verfahren an:
- Verhaltenstherapie: sehr strukturiert, problemorientiert, lösungsfokussiert
- Tiefenpsychologisch fundierte Therapie: arbeitet an unbewussten Mustern und inneren Konflikten
- Analytische Psychotherapie: sehr tiefgehend, oft über mehrere Jahre
- Systemische Therapie: bezieht Familie oder soziale Systeme mit ein
- Humanistische Verfahren: Gesprächstherapie, Gestalttherapie, klientenzentriert
Tipp: Beim Erstgespräch kannst Du nach der Ausrichtung der Praxis fragen – auch persönliche Passung ist ein wichtiger Faktor.
Woran Du erkennst, dass Du Hilfe brauchst
Viele Menschen fragen sich: „Bin ich überhaupt therapiebedürftig?“ Wenn Du dauerhaft unter folgenden Symptomen leidest, kann psychotherapeutische Unterstützung hilfreich sein:
· Anhaltende Schlafstörungen
· Gedankenkreisen, Sorgen, Grübelzwang
· Rückzug aus sozialen Kontakten
· Keine Freude mehr an früher schönen Dingen
· Körperliche Beschwerden ohne Befund
· Gefühle von Hilflosigkeit, Angst, Sinnlosigkeit
· (…)
Hinweis: Dieser Artikel ersetzt keine professionelle psychologische oder medizinische Beratung. Bei akuten Krisen wende Dich bitte an einen Arzt oder die Notfallambulanz.
Alternativen zur klassischen Einzeltherapie
Nicht jeder findet sofort einen Einzelplatz – und nicht jeder braucht diesen zwingend als erste Maßnahme. Weitere Formate:
- Gruppentherapie: Viele Praxen und Kliniken bieten Gruppensettings an, etwa für Depressionen, Angststörungen oder Burnout.
- Online-Angebote: Plattformen wie Selfapy, HelloBetter oder MoodGym bieten digitale Programme, teils von Krankenkassen übernommen.
- Kurzzeitinterventionen (Krisenintervention): Einige Praxen bieten Sprechstunden mit wenigen Sitzungen zur akuten Stabilisierung an.
Diese Formate sind wissenschaftlich anerkannt und können helfen, die Wartezeit sinnvoll zu nutzen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Deine Suche
- Wohnort und Umkreis definieren: Bis zu 45 Minuten Fahrt sind realistisch.
- Praxenlisten sichten: Auf arztsuche.116117.de oder www.therapie.de nach PLZ suchen.
- Tabelle anlegen: Liste mit Name, Telefonnummer, E-Mail, Rückmeldung.
- Kontaktieren (Telefon + E-Mail): Freundlich, aber direkt anfragen: „Bieten Sie aktuell freie Therapieplätze an?“
- Auf Wartelisten setzen lassen: Auch ohne Sofortplatz ist das wertvoll.
- Anrufen statt Warten: Wenn Du keine Antwort bekommst, lohnt sich oft ein zweiter Versuch.
Fazit: Dein Notfallplan bei langem Warten
- Möglichst viele Praxen kontaktieren: Nutze Plattformen wie „Therapieplatz-jetzt“, frage Kliniken, Universitätsambulanzen oder medizinische Versorgungszentren.
- Kostenübernahme für Privattherapie prüfen: Bei mehr als drei Monaten Wartezeit hast Du evtl. Anspruch auf Erstattung durch die Krankenkasse – auch wenn der Therapeut keine Kassenzulassung hat.
- Digitale & Gruppenangebote ergänzen: Online-Therapien (Digitale Gesundheitsanwendungen) und Gruppenangebote können die Wartezeit sinnvoll überbrücken
- Selbsthilfe & Coaching nutzen: Buch-Tipp Warten auf die Psychotherapie? mit Apps, Selbsthilfegruppen, Podcasts.
Foto: Antoni Shkraba Studio, https://www.pexels.com/de-de/foto/paar-hande-menschen-entspannung-5217840/
Text: Tim H., mit Unterstützung von KI erstellt